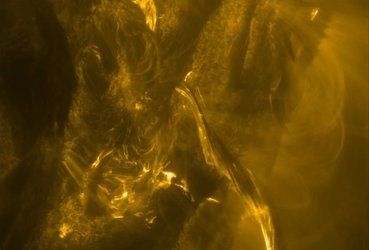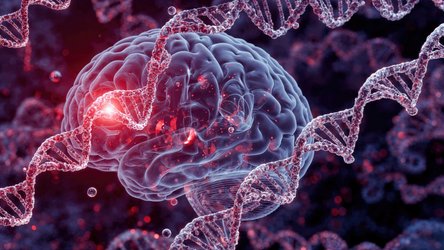Der Göttingen Campus

Der Standort Göttingen steht für internationale Spitzenforschung. Damit dies auch künftig so bleibt, haben sich die Universität Göttingen einschließlich der Universitätsmedizin Göttingen und sieben außeruniversitäre lokale Forschungszentren zum Göttingen Campus zusammengeschlossen.

Die Campuspartner haben durch die Nutzung ihrer gemeinsamen Stärken und Potenziale ein einzigartiges Umfeld geschaffen, welches die Vielfalt und einen aktiven Austausch zwischen Professoren, Forschern und Doktoranden fördert.

Derzeit arbeiten mehr als 5.900 Forscherinnen und Forscher in fast allen wissenschaftlichen Disziplinen am Göttingen Campus.